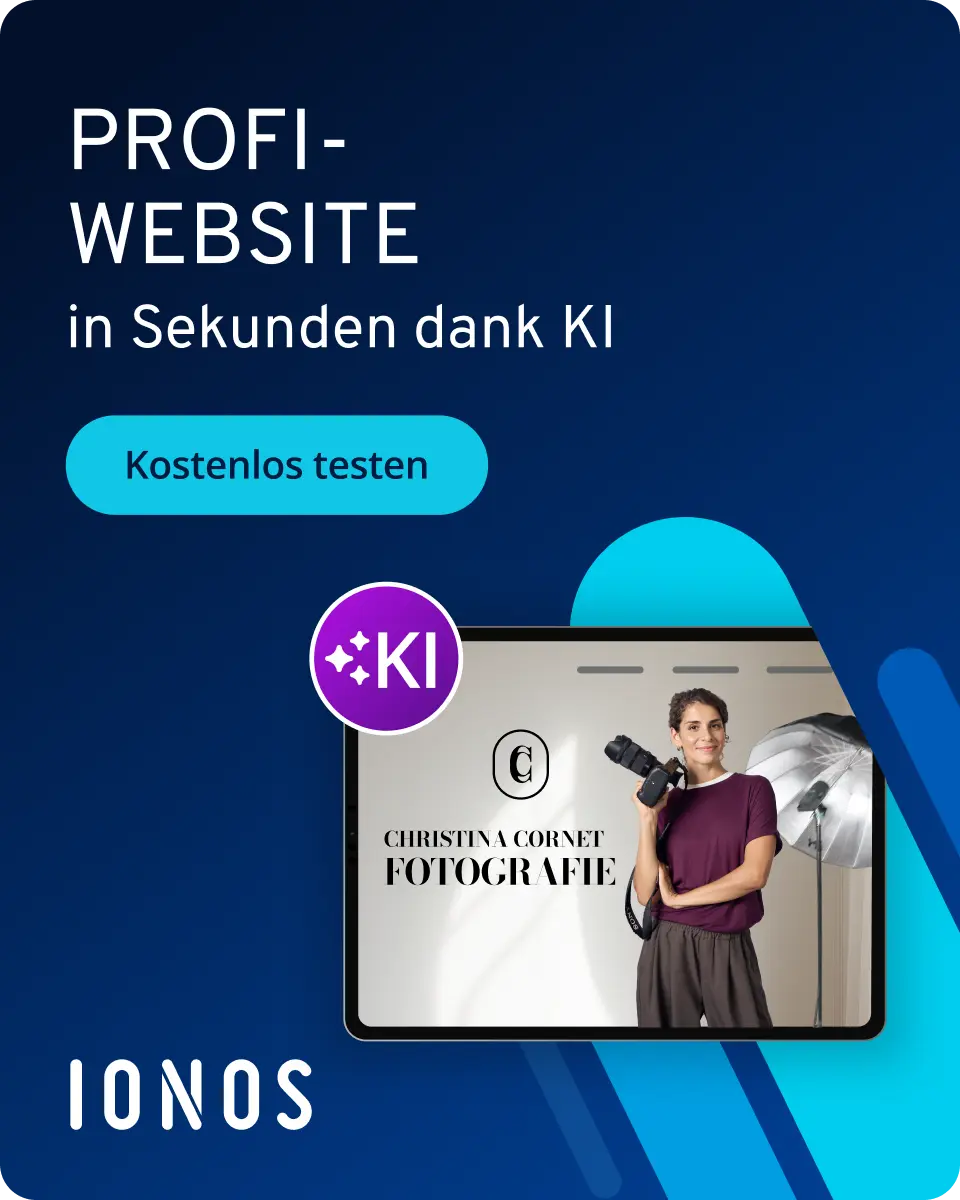Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG): Was Unternehmen wissen müssen
Ab dem 28. Juni 2025 gilt das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verbindlich für viele digitale Produkte und Dienstleistungen. Welche rechtlichen Grundlagen gelten, wie überprüft man die Barrierefreiheit einer Website und mit welchen Tools lässt sich die Umsetzung effizient gestalten?
Gesetzliche Grundlage: EU-Richtlinie wird deutsches Gesetz
Der Ursprung des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) liegt auf EU-Ebene: Mit der Richtlinie (EU) 2019/882, bekannt als European Accessibility Act (EAA), hat die Europäische Union einen einheitlichen Rechtsrahmen geschaffen, um digitale Barrieren in Produkten und Dienstleistungen abzubauen. Ziel ist ein einheitlicher Mindeststandard für Barrierefreiheit im EU-Binnenmarkt.
Diese Richtlinie wurde am 17. April 2019 verabschiedet und musste bis spätestens 28. Juni 2022 in nationales Recht überführt werden. Deutschland hat dies mit dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz getan, das am 22. Juli 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Die praktische Umsetzungspflicht für betroffene Unternehmen beginnt am 28. Juni 2025.
Wer ist betroffen?
Das BFSG gilt für eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen wie z. B.:
- E-Commerce-Websites und Online-Shops
- Digitale Buchungssysteme und Banking-Apps
- Selbstbedienungsterminals (z. B. Geldautomaten)
- Digitale Endgeräte wie Smartphones, Router oder E-Book-Reader
- Software mit Endnutzeroberfläche (z. B. Apps mit Login)
Kleinstunternehmen sind nur dann ausgenommen, wenn sie ausschließlich Dienstleistungen erbringen – sobald jedoch Produkte hergestellt oder verkauft werden, greift das Gesetz auch hier.
Auch wenn Ihre Website nicht gesetzlich verpflichtet ist – Barrierefreiheit lohnt sich! Viele Ausnahmen gelten nur formal. In der Praxis profitieren alle Websites von besserer Zugänglichkeit, höherer Usability und besserem SEO.
Was verlangt das Gesetz konkret?
Das BFSG verpflichtet viele Unternehmen, ihre digitalen Angebote ab dem 28. Juni 2025 barrierefrei zu gestalten. Die Anforderungen beruhen auf mehreren Ebenen – international, europäisch und national:
- Die WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) wurden vom W3C entwickelt und bilden seit Jahren die internationale Grundlage für eine barrierefreie Webseite. Sie definieren konkrete Erfolgskriterien für barrierefreie Inhalte und User-Interaktionen.
- Aufbauend auf den WCAG wurde 2019 der European Accessibility Act (EAA) als EU-Richtlinie verabschiedet. Diese schreibt vor, dass bestimmte digitale Produkte und Dienstleistungen in der EU barrierefrei gestaltet sein müssen.
- Der EAA wurde 2021 in Deutschland durch das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz in nationales Recht überführt. Dieses regelt konkret, welche Unternehmen betroffen sind, welche Sanktionen bei Verstößen drohen und welche Anforderungen umzusetzen sind.
- Die Umsetzung in der Praxis erfolgt anhand der EN 301 549, der harmonisierten technischen Norm, die die Anforderungen aus dem EAA und den WCAG konkretisiert – z. B. zu Kontrasten, Tastaturnavigation oder Alternativtexten.
Gesetz, Richtlinie und Norm – wie alles zusammenhängt
Die gesetzlichen Anforderungen zur digitalen Barrierefreiheit basieren auf drei Ebenen:
- Der European Accessibility Act (EAA) ist die EU-Richtlinie, die Barrierefreiheit für bestimmte digitale Produkte und Dienstleistungen vorschreibt.
- Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist das deutsche Umsetzungsgesetz des EAA und legt fest, wer in Deutschland was einhalten muss.
- Die EN 301 549 ist die dazugehörige technische Norm, die konkret beschreibt, wie digitale Barrierefreiheit umzusetzen ist.
Grundlage der Norm sind die WCAG-2.2-Richtlinien mit ihren Erfolgskriterien der Stufen A, AA und AAA. Für die Praxis sind insbesondere die Stufen A und AA verpflichtend.
Check: Ist Ihre Website BFSG-konform?
Sie sind betroffen? Dann sollten Sie folgende Schritte einleiten:
- Analyse & Audit: Barrierefreiheits-Check mit Tools wie Lighthouse, axe DevTools, WAVE oder dem BITV-Test durchführen.
- Umsetzung nach Standards: WCAG 2.2 und EN 301 549 einhalten.
- Barrierefreiheitserklärung veröffentlichen: Transparenz schaffen und Feedback ermöglichen.
- Regelmäßige Tests & Wartung: Barrierefreiheit ist kein Einmalprojekt.
Kombinieren Sie automatisierte Tests mit echten Nutzertests. Nur so lassen sich reale Barrieren identifizieren, die Tools übersehen – z. B. unverständliche Fehlermeldungen oder inkonsistente Navigation.
Tools und Plugins zur Unterstützung
Bei der Überprüfung der Barrierefreiheit können Tools wie Google Lighthouse behilflich sein. Die Tools haben jeweils die folgenden Vorteile:
| Tool | Funktion | Typ |
|---|---|---|
| Google Lighthouse | Automatisierte Analyse im Chrome DevTools | Open Source |
| Deque axe | Erweiterung für Entwickler mit Fehlerdiagnose | Kostenlos |
| PAC 3 | Prüfung barrierefreier PDFs | Kostenlos |
| Eye-Able | Frontend-Widget für User-Anpassungen | Lizenzpflichtig |
| Siteimprove / Monsido | Monitoring großer Sites inkl. SEO und Barrierefreiheit | Abo |
Pflege und Aktualisierung: Barrierefreiheit ist ein fortlaufender Prozess
Die Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderungen ist kein einmaliges Projekt. Vielmehr verlangt das BFSG, dass die Barrierefreiheit dauerhaft sichergestellt wird – auch bei Änderungen an digitalen Angeboten.
Das bedeutet konkret: Wenn Sie Ihre Website technisch oder inhaltlich überarbeiten – sei es durch neue Funktionen, einen Website-Relaunch oder ein Design-Update –, müssen diese Änderungen erneut auf Barrierefreiheit geprüft und gemäß den geltenden Standards umgesetzt werden.
Besonders relevant ist das bei:
- neuen oder überarbeiteten Seiten, Formularen oder Navigationselementen
- neuen Multimedia-Inhalten wie Videos, PDFs oder Grafiken
- Systemwechseln, etwa beim CMS oder Webhosting
- Integration neuer Drittanbieter-Komponenten (z. B. Buchungstools)
Auch bestehende Inhalte sollten regelmäßig überprüft werden, um langfristig konform zu bleiben.
Empfehlung: Wartungsplan etablieren
Um die langfristige Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen, sollten Unternehmen Barrierefreiheit als festen Bestandteil ihrer digitalen Wartungsprozesse etablieren. Ein strukturierter Plan hilft dabei, technische und redaktionelle Änderungen regelmäßig zu überprüfen und Barrieren frühzeitig zu erkennen. Hierzu helfen:
- Regelmäßige manuelle und automatisierte Tests (z. B. halbjährlich)
- Schulung von Webverantwortlichen sowie Redakteurinnen und Redakteuren
- Feedbackmechanismus zur Erfassung von Barrieren
- Aktualisierung der Barrierefreiheitserklärung, wenn sich Inhalte oder Umsetzungen ändern
Was droht bei Verstoß?
Ab dem 28. Juni 2025 werden BFSG-Verstöße rechtlich sanktioniert. Mögliche Folgen sind:
- Bußgelder bis zu 100.000 Euro
- Abmahnungen und wettbewerbsrechtliche Klagen
- Verlust öffentlicher Fördermittel
- Reputationsschäden
- Rückstufung in Suchmaschinenrankings
Ab Juni 2025 drohen bei Verstößen Bußgelder bis zu 100.000 Euro. Zusätzlich riskieren Sie Imageschäden, SEO-Verluste und sogar die Sperrung Ihrer Website. Jetzt handeln schützt vor späterem Aufwand.
Checkliste: So schaffen Sie digitale Barrierefreiheit
Diese Übersicht fasst die zentralen Anforderungen an barrierefreie Webangebote gemäß WCAG und EN 301 549 kompakt zusammen.
| Prüfkategorie | Anforderungen |
|---|---|
| Wahrnehmbarkeit | Alt-Texte für Bilder, Untertitel für Videos, ausreichende Farbkontraste |
| Bedienbarkeit | Navigation vollständig per Tastatur möglich, keine blinkenden Inhalte, Zeitsteuerung vermeidbar |
| Verständlichkeit | Klare Struktur, einfache Sprache, Hilfetexte bei Formularen |
| Robustheit | Semantisch korrekter HTML-Code, Unterstützung von Screenreadern, Kompatibilität mit assistiven Technologien |
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz ist mehr als nur Bürokratie: Es ist ein Aufruf zu mehr Inklusion im digitalen Raum – und eine Chance für Unternehmen, ihre Reichweite zu erhöhen, neue Zielgruppen zu erschließen und langfristig konkurrenzfähig zu bleiben.